Warum vielfältig kommunizieren (an der UZH)?
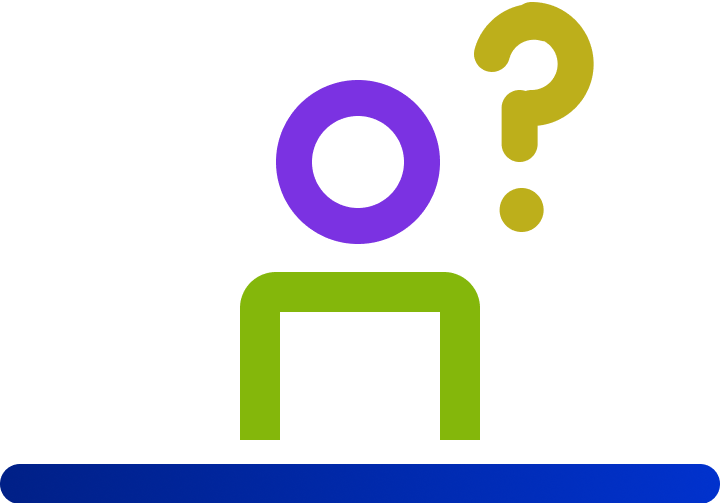
«Die UZH duldet mit Verweis auf die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft kein diskriminierendes Verhalten.» (Diversity Policy der UZH).
Gründe für eine diversitätssensible Kommunikation sowie grundlegende Gesichtspunkte thematisieren die untenstehenden Fragen und Antworten.
Was bedeutet gesellschaftliche Diversität, Intersektionalität und Geschlechtervielfalt?
| Begriff | Bedeutung | Weitere Infos |
|---|---|---|
| Diversität | Gesellschaftliche Diversität bezeichnet die Beobachtung, dass sich die Mitglieder in unserer Gesellschaft in vielen verschiedenen Diversitätsdimensionen voneinander unterscheiden. Zum Teil werden die Angehörigen unterrepräsentierter sozialer Gruppen übersehen oder sogar diskriminiert, indem ihnen gesellschaftliche Teilhabe erschwert oder versagt wird oder sie mit Stereotypen konfrontiert werden. Die Bedürfnisse einer dominanten Gruppe geraten dabei in den Vordergrund und es wird gesellschaftliche Vielfältigkeit ignoriert. | Gabriele Rosenstreich:Defining Diversity. In: Mira Karjalainen (Hrsg.): Engaging with Diversity in European Universities. UNA Europa 2022, S. 10–12. |
| Intersektionalität | Intersektionalität bedeutet, dass sich unterschiedliche Diskriminierungsformen bzw. Diversitätsfacetten überschneiden können. Dies wirkt sich auf die individuelle Erfahrung gesellschaftlichen Aus- oder Einschlusses aus: Eine Person kann aus verschiedenen Gründen mehrfach privilegiert oder mehrfach benachteiligt sein. | Erläuterungen zum Begriff der Intersektionalität bietet beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Artikel von Denise Bergold-Caldwell und Matti Traußneck oder das Portal Intersektionalität |
| Geschlechtervielfalt | «Geschlechtervielfalt» bedeutet, dass sich Personen nicht entweder als weiblich oder als männlich, sondern auch als nonbinär verstehen können. Personen mit einer nonbinären Geschlechtsidentität identifizieren sich weder als weiblich noch als männlich. Die Begriffe nicht binär, nonbinär oder nonbinary bezeichnen somit eine Vielzahl von möglichen Geschlechtsidentitäten. |
|
| Geschlechtsidentitäten | «Geschlechtsidentität» steht für die Selbstauffassung einer Person in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht. Diese Auffassung kann sich sowohl von gesellschaftlichen Zuschreibungen als auch der Geschlechtszuweisung bei der Geburt unterscheiden:
|
Ausführliche Erläuterungen zu Geschlechtsidentitäten sowie zusätzliche begriffliche Differenzierungen finden sich beispielsweise auch auf Gendern.ch. |
Welche allgemeinen Ziele verfolgt eine inklusive Kommunikation?
«Sprache hat Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen», so der Psycholinguist Pascal Gygax. Eine inklusive Sprache schärft somit die Aufmerksamkeit dafür, dass wir in einer sehr vielfältigen Gesellschaft leben. Diese soziale Wirklichkeit und unsere Sprache gleichen dabei einem Ping Pong Spiel: Die Realität in unseren Köpfen speist sich aus der Realität, die wir in Sprache oder in Bildern zum Ausdruck bringen.
Dieses Ping Pong Spiel hat die Forschung längst dingfest gemacht: Studien über Geschlechtsspezifik in Stellenausschreibungen zeigen beispielsweise schon sehr lange, dass das generische Maskulinum ungleiche gesellschaftliche Teilhabebedingungen befördert. Das bedeutet: Chancengleichheit in der Gesellschaft ist auch durch eine diversitätssensible Sprache zu haben.
Weiterführendes
Siehe zu der linguistischen Forschung von Pascal Gygax einen Artikel anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoist, dem auch das obenstehende Zitat entnommen ist (Artikel auf dem Newsportal des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation).
Was sind die Gründe für eine inklusive Kommunikation an der UZH?
Die UZH zielt im Sinne der 2018 erlassenen Diversity Policy auf eine diversitätssensible und diskriminierungsfreie Kommunikationsweise: «UZH-Angehörige pflegen einen diversitätsgerechten und inklusiven Kommunikationsstil. Die UZH setzt sich dafür ein, dass die Reproduktion von Stereotypen in Wort und Bild unterbrochen wird und allen UZH-Angehörigen ein barriere- und diskriminierungsfreier Zugang zu Informationen ermöglicht wird».
Schon seit dem 2005 eingeführtenVerhaltenskodex Gender Policy galt: «Der Sprachgebrauch der Angehörigen der Universität Zürich strebt grösstmögliche Sach- und Geschlechtergerechtigkeit sowie Eleganz an.»
Welchen Status haben die Empfehlungen zur inklusiven Kommunikation an der UZH?
Die UZH bietet den Angehörigen der Universität vielseitige Ausdrucksvarianten und grundlegende Erläuterungen zu einer inklusiven Kommunikation an. Sie werden dadurch ermutigt und angeregt, sich diversitätssensibel auszudrücken und haben auf der Grundlage der angebotenen Sprachvarianten die Freiheit, gemäss aktuellem Debattenstand umsichtige kommunikative Entscheidungen zu treffen.
Ausdrücklich abgeraten wird von der Verwendung des geschlechtsübergreifend verwendeten Maskulinums sowie davon, den Gebrauch des generischen Maskulinums mit einem Hinweis zu versehen, dass damit Personen aller Geschlechtsidentitäten mitgemeint seien (siehe dazu auch Carolin Müller-Spitzer: Geschlechtergerechte Sprache: Zumutung, Herausforderung, Notwendigkeit? In: Sprachreport 2 (2021), S. 1–12).
Wo liegen die Grenzen inklusiver Sprach- und Bildvarianten und der darauf bezogenen Empfehlungen?
Die UZH bleibt am Ball der fortlaufenden Debatte über inklusive Sprachvarianten, sowohl mit Blick auf die darauf bezogene Forschung als auch die Sichtweisen debattenbeteiligter Communities.
Die Debatte über diversitätssensible Sprache ist deshalb so dynamisch, weil Sprache selbst äusserst wandelbar ist: Es entwickeln sich kontinuierlich neue sprachliche Möglichkeiten, mehr Menschen einzuschliessen, sichtbar zu machen und anzuerkennen.
Das bedeutet auch, dass die vorliegenden Empfehlungen und Erläuterungen an vielen Stellen ausbaufähig sind und, dass sie im Laufe der Zeit angepasst sowie ergänzt werden müssen. In diesem Sinne ist die Qualität der Empfehlungen auf ein aufmerksames Publikum angewiesen, das für Beratung und Feedback gerne Kontakt aufnehmen darf.