Wie vielfältig kommunizieren in der Sprache?
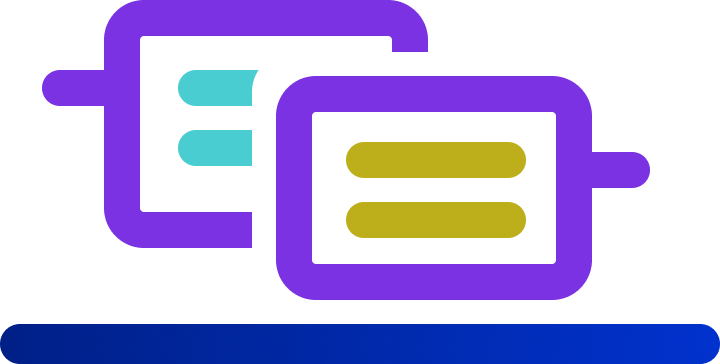
Die folgenden Fragen und Antworten sollen UZH-Angehörige zu einer diversitätssensiblen Kommunikation sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Austausch anregen. Da eine möglichst breite Orientierung geboten werden soll, schliessen die Erklärungen und Empfehlungen sowohl eine barrierefreie, eine diskriminierungsfreie als auch eine geschlechtssensible Ausdrucksweise ein.
Ziel der Ausführungen ist es, wohlinformierte Kommunikationsentscheidungen zu ermöglichen. Ausserdem sollen die vielseitigen Spielräume einer diversitätssensiblen Ausdrucksweise vorgestellt werden. Die jeweils zweiteilige Gliederung der Antworten folgt dieser doppelten Zielsetzung:
- Die Kategorie «Auf den Punkt gebracht» vermittelt jeweils zentrale Empfehlungen.
- Die Rubrik «Ausführlich erklärt» enthält ausführlichere Erläuterungen und detailliertere Empfehlungen.
Was sind die Grundsätze geschlechtergerechter Sprache?
Auf den Punkt gebracht:
- Geschlechtergerecht zu kommunizieren bedeutet, Personen oder Gruppen ihrer Geschlechtsidentität nach präzise zu bezeichnen. Das schliesst in vielen Zusammenhängen das geschlechtsübergreifende Maskulinum aus.
Ausführlich erklärt:
Geschlechtergerecht zu kommunizieren, leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Personen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität gesellschaftlich partizipieren können und nicht diskriminiert werden. Neben spezifischen Ausdrucksvarianten, die in einer separaten Box erläutert werden, gibt es einige empfehlenswerte Grundsätze geschlechtergerechter Sprache:
Präzision
Personen und Personengruppen sollten mit Blick auf ihre Geschlechtsidentitäten akkurat bezeichnet werden: Geht es um eine Gruppe Studierender, ist es beispielsweise in den seltensten Fällen realistisch, nur die männliche Form zu verwenden. Sind die Geschlechtsidentitäten der betreffenden Personen unbekannt, ist der Einsatz eines möglichst inklusiven Ausdrucks empfehlenswert, etwa des Genderdoppelpunkts oder eines geschlechtsneutralen Ausdrucks.
Anschaulichkeit
Zum Zwecke eines anschaulichen Sprachstils und der sprachlichen Ästhetik ist es sinnvoll darauf zu achten, gechlechtsneutrale und -abstrakte Ausdrücke sowie Passivkonstruktionen dosiert zu verwenden. Ein Aufsatz, Anschreiben oder Vortrag können bei grossem Aufkommen geschlechtsneutraler Ausdrücke distanziert wirken und eine erschwerte Lesbarkeit aufweisen.
Einheitlichkeit
Kommen Zeichen zur sprachlichen Abbildung von Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität (etwa der Genderdoppelpunkt oder der Genderstern) zum Einsatz, sollte innerhalb eines sprachlichen Zusammenhangs dasselbe Zeichen verwenden werden. Dies erleichtert nicht nur eine flüssige Rezeption, sondern ist vor allem für die Nutzung von Screenreadern wichtig.
Verzicht auf das generische Maskulinum
Im Sinne der sprachlichen Genauigkeit und Inklusivität wird davon abgeraten, das generische Maskulinum zu verwenden, insofern nicht tatsächlich nur männlich identifizierte Personen angesprochen oder bezeichnet werden sollen. Genauso wird nicht empfohlen, dem Einsatz des generischen Maskulinums eine Ankündigung voranzustellen, dass die männliche Form dennoch alle Geschlechter mitmeint. Dies ist eine Scheinlösung, weil de facto nicht alle Geschlechter sprachlich repräsentiert sind.
Weiterführendes
Carolin Müller-Spitzer: Geschlechtergerechte Sprache: Zumutung, Herausforderung, Notwendigkeit? In: Sprachreport 2 (2021), S. 1–12 sowie das Forschungsprojekt Empirische Genderlinguistik am Mannheimer Leibniz-Institut für Deutsche Sprache.
Was sind die Varianten geschlechtergerechter Sprache?
Auf den Punkt gebracht:
- Geschlechtsneutrale Ausdrucksweisen (Team, Mitglieder) sind deshalb sehr empfehlenswert, weil sie gut lesbar sind und keine Geschlechtsidentitäten ausklammern.
- Der Genderdoppelpunkt ist zur Sichtbarmachung von Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität und aufgrund der höheren Barrierefreiheit für Screenreadernutzende (gemäss den Empfehlungen der Stiftung «Zugang für alle») besonders empfehlenswert.
Ausführlich erklärt:
Es gibt unterschiedliche Optionen geschlechtergerechter Kommunikation, die jeweils verschiedene Aspekte inklusiver Kommunikation stärker oder schwächer berücksichtigen: Genderzeichen bringen beispielsweise eine umfassende Geschlechtervielfalt zum Ausdruck, demgegenüber die Doppelnennung der weiblichen und männlichen Form ein binäres Geschlechtsmodell repräsentiert. Die nachfolgende Gegenüberstellung der einschlägigsten Varianten geschlechtersensibler Sprache soll UZH-Angehörige in die Lage versetzen, gemäss aktuellem Debattenstand und je nach kommunikativem Zusammenhang geschlechtersensibel zu formulieren.
Geschlechtsneutrale Ausdrucksweisen
Was? Geschlechtsneutrale Ausdrücke sind Bezeichnungen, die das Geschlecht von bezeichneten Personen offenlassen.
Was zum Beispiel?
- Substantivierte Partizipien: Studierende, Dozierende (Achtung: Nur im Plural geschlechtsneutral, da im Singular das Geschlecht sichtbar wird, etwa bei der Studierende)
- Geschlechtsneutrale Ausdrücke: das Kollegium, alle, Person, Mittelbau
- Passivkonstruktionen: das Formular ist auszufüllen, die Vorlesung wurde besucht
Warum? Die Vorzüge geschlechtsneutraler Ausdrucksweisen sind, dass sie keine Geschlechtsidentitäten ausklammern und barrierearm sind, weil sie einfach auszusprechen sowie einfach zu schreiben und zu lesen sind. Die Verwendung geschlechtseutraler Ausdrucksweisen erleichtert das Lesen mithilfe eines Screenreaders und umgeht so die Herausforderung, fortlaufend auf den technologischen Wandel der entsprechenden Softwares einzugehen.
Warum nicht? Die Nachteile genderneutraler Ausdrücke sind, dass die Vielfalt von Geschlechtlichkeit nicht explizit sichtbar wird, wie dies beispielsweise der Genderdoppelpunkt als Zeichen für Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität repräsentiert. Neutrale Formen können bei zu häufiger Verwendung zudem als unpersönlich und objektivierend wahrgenommen werden (siehe hierzu die Erläuterungen im Sprachleitfaden der PH Zürich).
Wie? Auf der Suche nach geschlechtsneutralen Ausdrucksweisen können das Genderwörterbuch sowie die gender app helfen, und es lassen sich Aussagen zudem so umformulieren, dass die Geschlechtsidentitäten der bezeichneten Personen nicht genannt werden müssen (siehe dazu den Sprachleitfaden der PH Zürich).
Genderzeichen
Was? Der Genderstern sowie der Genderdoppelpunkt sind unter anderem Zeichen, die in Personenbezeichnungen eingefügt werden und die Menschen mit nonbinären Geschlechtsidentitäten stellvertreten (siehe zu darüber hinaus existierenden Genderzeichen die Sprachempfehlungen der Universität Basel). Der grammatikalische Status sowie auch die Barrierefreiheit von Genderzeichen befinden sich aktuell noch in der laufenden Aushandlung.
Was zum Beispiel?
- Plural: Handwerker*innen, Chef:innen
- Singular: Gewinner*in, Sänger:in
- Pronomen, Artikel und Adjektive: Eine einfache Möglichkeit bezüglich Pronomen, Artikeln und Adjektiven ist es, den Plural oder eine geschlechtsneutrale Formulierung zu verwenden (zum Beispiel: Die Podiumsdiskutant:innen/Podiumsteilnehmenden beginnen mit ihren Statements).
- Siehe zur Anpassung von Pronomen, Artikeln und Adjektiven im Singular die Sprachempfehlungen der Universität Hohenheim sowie die Erläuterungen auf genderleicht.de.
Warum? Das Plus von Sonderzeichen wie dem Genderdoppelpunkt und Genderstern ist, dass sie Personen mit allen, auch mit nonbinären Geschlechtsidentitäten ansprechen und sprachlich sichtbar machen. Der Genderstern hat den Vorteil, dass er von Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität als Selbstbezeichnung verwendet wird (siehe hierzu die Erläuterungen im Leitfaden auf gendern.ch). Gemäss den Einschätzungen der Stiftung «Zugang für alle» bietet es sich im Sinne einer barrierearmen Textgestaltung für Screenreadernutzende an, den Genderdoppelpunkt zu verwenden (siehe aber zur Berücksichtigung von Menschen mit geringem Sehvermögen und den Schwierigkeiten, den Genderdoppelpunkt zu erkennen, denLeitfaden auf gendern.ch).
Warum nicht? Auf der Minusseite steht, dass die existierenden Genderzeichen teilweise zu einer erschwerten Aussprache, Schreibweise und Lesbarkeit führen können und deshalb etwas weniger barrierearm sind.
Wie?
- Stern und Doppelpunkt werden zwischen die Teile eines Wortes eingefügt, die das Genus anzeigen. Das bedeutet: Mitarbeiter*in oder Mitarbeiter:in (siehe mit vielen Tipps zur Anwendung des Genderdoppelpunktes die Sprachempfehlungen der Universität Hohenheim)
- Ausgesprochen werden der Genderstern und der Genderdoppelpunkt durch eine kurze Pause: so wie zwischen «Spiegel – ei»
- Auf die Anpassung von Artikeln, Pronomen und Adjektiven an ein Genderzeichen kann verzichtet werden, wenn der Plural verwendet wird.
Doppelnennungen
Was? Gemeint ist mit Doppelnennungen die Verwendung der weiblichen und der männlichen Form im Plural oder im Singular.
Was zum Beispiel?
- Forscherinnen und Forscher
- ein Assistent oder eine Assistentin
Warum? Sprachlich einbezogen und adressiert sind weibliche und männliche Personen. Doppelnennungen können problemlos von Screenreadern ausgelesen werden.
Warum nicht? Doppelnennungen klammern aus ihrer Ansprache Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität aus. Es wird dadurch impliziert, dass es lediglich eine binäre Differenz zwischen weiblich und männlich gäbe.
Wie? Es steigert die Lesefreundlichkeit und ist grammatikalisch einfacher, im Falle von Doppelnennungen die gesamten Formen zu verwenden, als diese abzukürzen. Das bedeutet, «Studentinnen und Studenten» zu schreiben und nicht «Student/-innen» oder «Studentinnen/Studenten» (siehe hierzu und mit zusätzlichen Illustrationen den Sprachleitfaden der PH Zürich).
Weiterführendes
Für eine differenzierte Abwägung der unterschiedlichen genderbezogenen Schreibweisen siehe auch die Sprachempfehlungen der Universität Basel sowie die in unserer Linksammlung aufgeführten Ressourcen. Ausführliche und konkrete Formulierungstipps bieten insbesondere der Sprachleitfaden der Universität Hohenheim sowie der Leitfaden auf gendern.ch.
Wie nach der Geschlechtsidentität fragen und geschlechtsspezifische Pronomen verwenden?
Geschlechtsidentitäten in mündlicher Kommunikation thematisieren
In der mündlichen Kommunikation ist es ein guter Weg der inklusiven Kommunikation, interessiert und respektvoll nachzufragen, wie und mit welchen Pronomen Personen angesprochen werden möchten – auch, weil sich noch kein deutschsprachiges Pronomen für Personen ohne binäre Geschlechtsidentität etabliert hat (siehe dazu auch die Erklärungen auf nonbinary.ch). Alle Teilnehmenden einer Vorstellungsrunde können sich beispielsweise mit Namen und dem jeweils präferierten Pronomen vorstellen. Die Nennung bzw. die Nachfrage nach Pronomen wird normaler und unbefangener, wenn dies alle – und also nicht nur Personen mit nonbinärer Geschlechtsidentität – tun (siehe einen entsprechenden Tipp auf nonbinary.ch).
Schriftbasierte Abfrage von Personenmerkmalen
Es heisst Personen aller Geschlechtsidentitäten willkommen und ist deshalb inklusiv, wenn in Abfragemasken oder Formularen mindestens drei Antwortmöglichkeiten nach dem Geschlecht oder ein Freifeld als Antwortoption angeboten werden. So steigt die Wahrscheinlichkeit, die Geschlechtsidentitäten möglichst vieler antwortender Personen aufnehmen zu können (zu weiterführenden Hinweisen für die inklusionssensible Erstellung von Formularen
Leitfaden Geschlecht erfragen (TGNS) (PDF, 134 KB) ). Eine positive und deshalb empfehlenswerte Antwortmöglichkeit ist «divers». Generell sollte das Geschlecht aber nur in den Fällen abgefragt werden, in denen es tatsächlich relevant ist. In der schriftlichen Kommunikation kann es ein Weg inklusiver Kommunikation sein, eine Person neutral anzusprechen, wenn das Geschlecht noch nicht bekannt ist (siehe hierzu die Empfehlungen im Leitfaden von gendern.ch).
Wie wird barrierefreie Kommunikation ermöglicht?
Auf den Punkt gebracht:
- Es hat sich allgemein das «Zwei-Sinne-Prinzip» bewährt: Eine Aussage soll möglichst in zwei der Sinnesdimensionen «Hören, Sehen, Tasten» vermittelt werden, damit Personen die Aussage auch dann verstehen können, wenn sie in Bezug auf eine Sinnesdimension beeinträchtigt sind.
- Es bietet sich an, im Vorfeld einer Veranstaltung die kommunikativen Bedürfnisse der Teilnehmenden zu erfragen, um adäquat darauf eingehen zu können.
Ausführlich erklärt:
Die folgenden Strategien können – beispielhaft und nicht erschöpfend – vor Augen führen, wie kommunikative Situationen je nach Kontext barrierearm und adressat:innengerecht gestaltet werden können.
Digitale Barrierefreiheit und haptische/akustische Verdoppelung
Für Personen mit Sehbehinderungen muss schriftlicher und visueller Content in der digitalen Kommunikation so dargestellt werden, dass dieser von einem Screenreader ausgelesen werden kann (siehe für konkrete Anwendungstipps die Accessibility-Checkliste der Stiftung «Zugang für alle»). In der analogen Kommunikation ist es wichtig, dass schriftliche oder bildliche Informationen auch haptisch oder akustisch verfügbar sind: beispielsweise in Brailleschrift (siehe hierzu beispielsweise die spezifischen Erläuterungen zu taktilen Beschriftungen des Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverbands).
Gebärdensprache und akustische Verstärkung
Menschen, die gehörlos sind, können in laut- und schriftsprachliche Formate durch gebärdensprachliche Zusatzangebote eingebunden werden. Für Personen mit Hörbehinderungen ist es wichtig, dass auf Veranstaltungen technische Ressourcen vorhanden sind, über die auditiver Content über Hörgeräte übertrag- und verstärkbar ist.
Zugängliche Sprache
Für Menschen mit geringer Sprach- und/ oder Lesekompetenz können schriftliche Aussagen in Einfacher oder Leichter Sprache vermittelt werden. Leichte Sprache ist ein spezielles Instrument zugänglicher Sprache mit einem festen Regelwerk; siehe hierfür beispielsweise den Leitfaden Leichte Sprache von MeteoSchweiz .
Sprachliche Reduktion auf Behinderungen vermeiden
Personen mit Behinderungen sollten sprachlich nicht auf ihre körperlichen Voraussetzungen reduziert werden. Dafür ist es wichtig zu formulieren, dass eine Person beispielsweise eine Hörbehinderung oder eine kognitive Behinderung hat, anstatt das entsprechende Adjektiv («hörbehindert») als kennzeichnend für die Person zu verwenden. Zu beachten ist auch, dass sich nicht alle Menschen mit Behinderungen selbst mit fachlich etablierten Fremdbezeichnungen identifizieren.
Weiterführendes
Anleitungen zur barrierefreien Kommunikation sowie Erläuterungen zu einer diskriminierungsfreien Sprache in Bezug auf Behinderungen finden sich in unserer Linksammlung unter den Stichworten Barrierefreiheit und Inklusion.
Was sollte mit Blick auf Zuschreibungen zur religiösen, kulturellen oder nationalen Zugehörigkeit einer Person(engruppe) beachtet und was unterlassen werden?
Auf den Punkt gebracht:
- Es sind Bezeichnungen zu unterlassen, durch die Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder nur vermuteten religiösen, kulturellen oder nationalen Zugehörigkeit sowie wegen Zuschreibungen zu ihrem Aussehen herabgewürdigt werden.
- Über die religiöse, kulturelle oder nationale Zugehörigkeit einer Person sollte nur dann informiert werden, wenn es für den Sachzusammenhang tatsächlich relevant ist.
Ausführlich erklärt:
Eine diversitätssensible Kommunikation zielt darauf ab, dass alle Personen respektvoll angesprochen und nicht herabgewürdigt werden. Diskriminierende Zuschreibungen zur nationalen, religiösen oder kulturellen Zugehörigkeit sowie zu physiologischen Merkmalen einer Person sollten unterlassen werden. Ein diversitätssensibler Sprach- und Abbildungsstil verzichtet auf Ausdrucksweisen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeglicher Form transportieren (siehe hierzu die Erläuterungen zu GMF der Bundeszentrale für politische Bildung).
Die nachfolgenden Anregungen konzentrieren sich auf eine Sprache, die frei ist von rassistischen und antisemitischen Ausdrucksweisen sowie Bezeichnungen, die antimuslimischen Rassismus sowie Rassismus gegenüber Jenischen, Sinti/Manouches oder Roma vermitteln. Es kann helfen, sich in der Formulierung von Aufsätzen, Anschreiben oder dem mündlichen Austausch an den folgenden Reflexionsfragen und Grundsätzen zu orientieren:
- Ist es in dem betreffenden Zusammenhang sachlich relevant, etwa auf eine nationale, religiöse oder kulturelle Zugehörigkeit einer Person(engruppe) zu verweisen? Dies gilt es, kritisch zu reflektieren.
- Benutze ich zur Charakterisierung einer Person(engruppe) Worte, die aus asymmetrischen Gesellschaftsverhältnissen entstanden sind und diese reproduzieren? Die Reflexion dieser Frage bedarf einer steten Aufmerksamkeit und Bildung, für die beispielweise das Glossar der Fachstelle für Rassismusbekämpfung zur Verfügung steht.
- Vermittele ich mit spezifischen Begriffen und Bezeichnungen gruppenbezogene Charakterisierungen, die eine Person aufgrund der angenommenen religiösen, nationalen oder kulturellen Zugehörigkeit stereotypisieren? Dies sollte ich selbstkritisch reflektieren und unterlassen, indem ich mich über diskriminierende Sprache informiere: zum Beispiel über das Glossar der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
- Gibt es bei den von mir benutzten Ausdrücken mit Bezug auf die religiöse, kulturelle oder nationale Zugehörigkeit einer Person einen Unterschied, ob diese eine Selbst- oder Fremdbezeichnung sind? Für die Aneignung einer diskriminierungsfreien Sprache ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass einige gruppenbezogene Ausdrucksweisen zwar als positive Selbstbezeichnungen akzeptiert werden, aber als Fremdbezeichnungen diskriminierende Effekte haben können. Es ist deshalb ratsam, für die Selbstbezeichnungen einer Person aufmerksam zu sein und sich danach gegebenenfalls zu erkundigen, dies aber nicht unbedingt als Auftakt eines Austausches zu tun. (siehe zur Differenz zwischen Selbst- und Fremdbezeichnungen ausführlicher Tupoka Ogette: Und jetzt du. Zusammen gegen Rassismus. München 2023, S. 47–59).
Weiterführendes
Aus dem breiten Spektrum vorhandener Debattenbeiträge sind in unserer Linkliste viele Ressourcen zusammengestellt, die für sprachliche Diskriminierungseffekte sensibilisieren können.